Warenkorb
Händlerauswahl
Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.
Händler



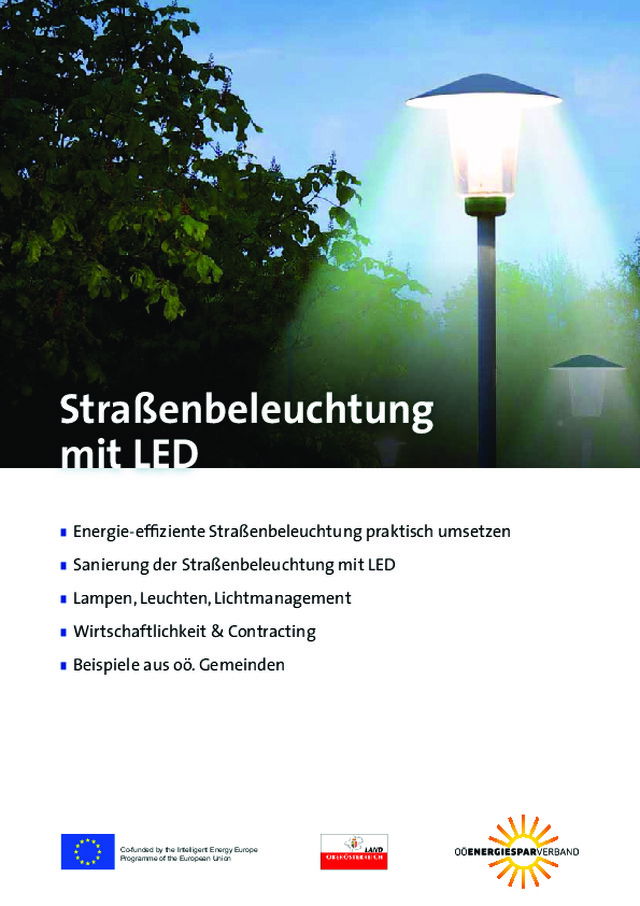
Straßenbeleuchtung mit LED
Die Straßenbeleuchtung muss unterschiedliche Interessen, Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche erfüllen und zugleich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushalte berücksichtigen.
Straßenbeleuchtung mit LED Co-funded by the Intelligent Energy EuropeProgramme of the European Union Energie-effiziente Straßenbeleuchtung praktisch umsetzen Sanierung der Straßenbeleuchtung mit LED Lampen, Leuchten, Lichtmanagement Wirtschaftlichkeit & Contracting Beispiele aus oö. Gemeinden
2 Bildnachweis: Philips, OSRAM Opto Semiconductors, OÖ Energiesparverband Quellen: Lichttechnische Gesellschaft Österreichs (LTG); Land OÖ, Abt. Straßenbau; Amt der NÖ Landesregierung, Geschäftsstelle für Energiewirtschaft; Lebensministerium; www.licht.de; Energieinstitut Vorarlberg; Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Diese Broschüre wurde sorgfältig erstellt, jede Haftung für die Angaben wird jedoch ausgeschlossen. Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autor/innen. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Weder die EASME noch die Europäische Kommission übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen. 3 Energie-eff iziente Straßenbeleuchtung 4 LEDs in der Straßenbeleuchtung 6 Schritt für Schritt zur energie-effizienten Straßenbeleuchtung 8 Worauf Sie beim Umstieg auf LEDs achten sollten 10 Wichtige technische Komponenten 13 Licht & Naturschutzaspekte 14 Wirtschaftlichkeit & Finanzierung 16 Energie-Contracting 18 Beispiele 26 Planungsgrundlagen 27 Begriffe Inhalt
3 Die Straßenbeleuchtung muss unterschiedliche Interessen, Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche erfüllen und zugleich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushalte berücksichtigen. Die Qualität einer normgerecht ausgeführten Straßenbeleuchtung steigert die Wohnqualität und die Zufrie- denheit der Bürger/innen. Sie schützt die Umwelt durch Vermeidung von Lichtimmissionen, hilft Energie zu sparen und gewährleistet die persönliche Sicherheit der Anrainer/innen. Sie dient dem Schutz des Eigentums und bewahrt vor Unfällen. Die Straßenbeleuchtung ist für bis zu 45 % der gesamten Stromkosten einer durchschnittlichen Gemeinde verantwortlich und stellt damit einen wichtigen Kostenfaktor in der Gemeinde dar. Neben den Kosten ist auch die Betriebssicherheit ein wichtiges Thema, denn mit dem Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlage hängen auch Haftungsfragen zusammen. Bereits mit der heute verfügbaren Technik kann der Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung um mehr als 50 % gesenkt werden. Zwar ist eine moderne, energiesparende Straßenbeleuchtung in der Anschaffung zumeist teurer, auf längere Sicht werden aber damit die Betriebskosten erheblich gesenkt. Zudem wird in der Regel auch die Lichtqualität deutlich verbessert. Hier kann Energie-Contracting einen wichtigen Beitrag leisten. Jedenfalls lohnt sich der Umstieg, wenn ohnehin Maßnahmen anstehen. Aber auch wenn die Straßenbeleuchtung nicht komplett ausgetauscht bzw. neu errichtet werden soll, gibt es Möglichkeiten, Strom zu sparen und die Beleuch- tungssituation zu verbessern. Einen wichtigen Aspekt im Bereich der Straßenbeleuchtung bringt die EU-Verordnung Nr. 245/2009, durch die ineffiziente Beleuchtungstechnologien schrittweise vom Markt genommen werden. Dies betrifft vor allem Quecksilberdampf-Hochdrucklampen und Natriumdampf-Hochdruck-Plug-in-Lampen. Diese Broschüre informiert über: Wie kann effiziente Straßenbeleuchtung praktisch umgesetzt werden? Was tun bei einer anstehenden Sanierung? Was sind die wichtigsten Komponenten der Straßenbeleuchtung? Was können LEDs schon heute in der Straßenbeleuchtung? Wie steht es um Wirtschaftlichkeit & Finanzierung? Ist die Umsetzung mittels Energie-Contracting eine sinnvolle Lösung? Was ist normgerechte Beleuchtung? Licht & Naturschutzaspekte Energie-effiziente Straßenbeleuchtung
4 Warum LEDs? Bisher waren vor allem Natriumdampf-Hochdrucklampen und Halogen-Metalldampflampen der in der Straßenbeleuchtung verwendete Standard. Vermehrt steigen Gemeinden auf LED-Technik um. Durch die rasche Weiterentwicklung der LED-Technik steigt deren Effizienz kontinuierlich. So erreichen weiße LEDs im praktischen Betrieb schon eine Energie-Effizienz von bis zu ca. 120 lm/W. Im Vergleich dazu erreichen Natriumdampf- Hochdrucklampen Werte von 90 bis 150 lm/W. Vorteile der LED: hohe Flexibilität und exakte Lichtlenkung (Vermeidung von unerwünschtem Streulicht) lange Lebensdauer (mind. 50.000 Stunden, zum Vergleich: Natriumdampf-Hochdrucklampen ca. 16.000 Stunden) geringer Wartungsaufwand (bis zu zehn Jahre im Gebrauch wartungsfrei) Farbtemperatur des weißen Lichts frei wählbar (exakte Abstufungen möglich) dynamische Anpassung des Lichts an die Nutzung möglich (Dimmbarkeit, sofortige On/Off-Schaltung) weißes LED-Licht ist technologiebedingt frei von UV- und Infrarotstrahlung und damit auch insektenfreundlicher Beispiel Energieeinsparung durch Umstieg auf LED-Beleuchtung LEDs in der Straßenbeleuchtung Kosten über die Lebensdauer (Lebenszykluskosten) Kosten in 5 Jahren (Euro/Lampe) Kosten in 15 Jahren (Euro/Lampe) Lampentyp Investition Strom Wartung gesamt Investition Strom Wartung gesamt Quecksilberdampf- Hochdrucklampe 4 321 175 555 12 964 525 1500 LED 160 67 60 302 319 201 180 700 Durch Umrüsten von Quecksilberdampflampen auf Natriumdampflampen können etwa 15 % an elektrischer Energie eingespart werden. Bei einer Umrüstung auf Halogen-Metalldampflampen kann der Stromverbrauch um etwa 40 %, bei Wechsel auf LED-Beleuchtung um bis zu 70 % reduziert werden. Nicht berücksichtigt ist hier noch die Einsparung durch eine effiziente Steuerung der Beleuchtung oder eine Teilnachtschaltung. Damit können zusätzlich bis zu ca. 20-30 % an elektrischer Energie eingespart werden. Alte Technologie. Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, 125 W mit KVG 15 % Tausch der Lampe auf Natriumdampf-Hochdrucklampe, 110 W 40 % Tausch der Lampe auf Halogen-Metalldampflampe, 70 W 55 % Neue Leuchte mit Hochdruck-Entladungslampe 70 % Neue Leuchte mit Hochdruck- Entladungslampe und Lichtregelung 80 % Gesamteinsparung zukünftig möglich Neue Leuchte mit LED- Lampe & Lichtregelung Energieeinsparung 100 % 50 % 0 % 100 % Energieeinsparung 50 % 0 % Einsparpotenziale Straßenbeleuchtungstechnologien Natriumdampf-Hochdrucklampe oder Halogen-Metalldampflampe Natriumdampf-Hochdrucklampe oder Halogen-Metalldampflampe mit Lichtregelung (50 % Leistung während 2000 Stunden) mit Lichtregelung (50 % Leistung während 2000 Stunden) Quelle: licht.de
5 Finanzierung mit Energie-Contracting Eine Möglichkeit, die Sanierung von Straßenbeleuchtung ohne gemeindeeigene Investitionsmittel zu finanzieren und umzusetzen, bietet Energie-Contracting. Dabei wird die Straßenbeleuchtung von einem spezi- alisierten Unternehmen, dem Contractor, geplant, errichtet und finanziert. Refinanziert wird die Investitionen durch die erzielte Energieeinsparung. Mehr dazu auf Seite 16. "OK und KO Faktoren" für Contracting in der Straßenbeleuchtung Wenn Sie für Ihre Gemeinde alle oder fast alle Fragen in der Tabelle mit "JA" beantworten, dann könnte Energie- Contracting in Ihrem Fall eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zur Sanierung der Straßenbeleuchtung (oder Teilen davon) darstellen. Positive / negative Faktoren für Contracting zur Sanierung der Straßenbeleuchtung JA NEIN Anlage älter als 10 JahreLänge der Straße, die saniert werden soll, ist mehr als 1 km bzw. mehr als 50 Lichtpunktedie jährliche Brenndauer ist mehr als 3.600 Stundenes gibt keine Nachtabschaltung bzw. Nachtabsenkungdie Aufbringung von Investitionsmittel durch die Gemeinde ist schwierig
6 Schritt für Schritt zur energie-effizienten Straßenbeleuchtung Nehmen Sie sich Zeit für eine gute Vorbereitung und Planung. Ziel sollte sein, die Straßenbeleuchtung so zu gestalten, dass die Strom- und Wartungskosten deutlich verringert werden, die Gütekriterien den Normen entsprechen und die Sicherheit gewährleistet ist. 1. Schritt: Abschätzung der Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen Zur ersten Abschätzung, ob eine Sanierung der Straßenbeleuchtung wirtschaftlich umsetzbar ist, können Sie folgende Grunddaten erheben. Mit diesen Angaben können Sie dann zum Beispiel von Planern, Contractoren oder beim OÖ Energiesparverband eine erste Abschätzung der Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen erhalten. 2. Schritt: Genaue Aufnahme des Ist-Zustandes der Anlage Für die Umsetzung ist eine genaue Bestandsaufnahme unumgänglich, egal, ob das Projekt von der Gemeinde oder von einem Contractor oder Planer umgesetzt wird. Angaben zu den beleuchteten Straßen in Bezug auf: Straßennutzung (Hauptstraße, Wohnstraße, …) Konfliktzonen (Kreuzungsbereich, Schutzweg, Kreisverkehr, …) Straßenlänge Wichtige Angaben zu Ihrer Straßenbeleuchtung Baujahr des ältesten Teils der AnlageWann war die letzte größere Sanierung?Anzahl der LichtpunkteHäufigster LampentypBeleuchtete Straßenlänge (optional) [km]Zustand der Masten [gut/schlecht]Gesamte installierte elektrische Leistung (Nennleistung) [kW] Gesamter jährlicher Stromverbrauch der Anlage [kWh/Jahr]Stromkosten (inkl. Steuern und Abgaben) [Euro/kWh]Gesamte jährliche Wartungskosten [Euro] (Austausch von Lampen, Reparatur) (Schätzung)Einschaltzeiten [von–bis] oder Brenndauer [Stunden/Jahr]Gibt es reduzierte Beleuchtung, Nachtabschaltung, etc.?
7 Erhebung der Lichtpunkte: Folgende Daten sollten für jeden Lichtpunkt aufgenommen werden. Die gleichzeitige Erhebung des Leuchten- und Mastzustandes ist zu empfehlen. Beispiel Lichtpunkterhebung einer Gemeinde Nr. Baujahr Standort Lichtpunkthöhe Lampentyp Lampenleistung Zustand Mast/Tragwerk Leuchte 1 2 ... 1985 2008 ... Musterstr. Nr. 3 Dorfplatz Nr. 11 ... 10 m 8 m ... TL HQL ... 72 W 50 W ... 2 1 ... 4 1 ... Beispiel, entsprechend den Gegebenheiten zu erweitern. Energieverteilung: Verkabelungsplan, Pläne der Schaltstellen Verteilereinbauten und deren Zustand Betriebskosten: Stromverbrauch und Wartungskosten aufgeteilt auf die verschiedenen Bereiche (Straßenzüge) der Anlage Messung: Punktuelle Messung der Beleuchtungsstärke oder der Leuchtdichte Spannungsmessung am Einspeisepunkt und am Ende des Stranges Strommessung an den einzelnen Strängen Überprüfung der elektrotechnischen Schutzmaßnahmen nach ÖVE/ÖNORM Sonderverbraucher: Weihnachtsbeleuchtung in kW pro Schaltstelle inkl. Einschaltzeiten (ja/nein) Sonderverbraucher in kW pro Schaltstelle inkl. Einschaltzeiten (z.B. Bushütten, beleuchtete Verkehrszeichen) 3. Schritt: Umrüstung oder Tausch der Leuchten? Je älter eine Leuchte ist, desto weniger sinnvoll ist meist deren Umrüstung auf moderne Leuchtmittel, da passende Vorschaltgeräte zumeist nicht kostengünstig erhältlich sind und eine Verbesserung der Effizienz durch die bestehende Lichtlenkung nicht gegeben ist. Auch hinsichtlich der Wartungskosten (Reinigung, Dichtheit, Störungsanfälligkeit u. v. m.) wird bei einer Umrüstung zumeist keine Verbesserung und somit keine langfristige Kostensenkung erreicht. In der Praxis hat sich gezeigt, dass aufgrund der technologischen Entwicklungen bei Lichtpunkten mit einem Alter über 10 Jahren in den meisten Fällen einem Tausch der Leuchte gegenüber einer reinen Umrüstung auf effiziente Leuchtmittel der Vorzug zu geben ist. Bei der Neugestaltung eines Straßenzuges sollten einheitliche Leuch- ten (Type/Leuchtmittel) zum Einsatz kommen. Durch diese einheitliche Gestaltung sinkt der Instandhaltungsaufwand und die Leuchtmittel können später mit einem Gruppentausch erneuert werden. 4. Schritt: Finanzierung & Umsetzung Information über mögliche Bundes- & Landesförderungen Umsetzung mittels Energie-Contracting überlegen
Lichtstrom [Lumen]: Gibt die Lichtleistung an, also wie hell eine Lampe ist. Darauf achten, ob sich die Lumen- Angaben auf den LED-Chip oder die gesamte LED-Leuchte beziehen. Lichtausbeute [Lumen/Watt]: Lichtstrom (wie hell die Lampe leuchtet) bezogen auf die elektrische Leistungsaufnah- me; so erkennen Sie, wie effizient die Lampe ist. Lebensdauer der LED und der Leuchten [Stunden]: Hersteller versprechen oft eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Betriebsstunden, aller- dings nur für einzelne Komponenten. Hier genau auf die Angaben achten und Garantien einfordern. Lichtstromrückgang: LEDs zeigen bei korrektem Betrieb eine extrem niedrige Ausfallsrate. Aber wie bei allen Leuchtmitteln verringert sich die Lichtausbeute im Laufe der Nutzungsdauer (Rückgang bis auf 70 % nach 50.000 Betriebsstunden). Das bedeutet bei normkonformem Betrieb einer Beleuchtungsanlage entweder eine deutliche Überdimensionierung zu Beginn (nicht emp- fehlenswert) oder die Verwendung einer elektronisch geregelten Lichtstromkompensation. Für eine Beurteilung der Lebensdauer bei LEDs sollten Angaben zur Ausfallsrate und zum Lichtstromrückgang getrennt angegeben und berücksichtigt werden. Beispiel "L70/B50": "L70" bedeutet, dass die Lampe am Ende der angegebenen Lebens- dauer noch mindestens 70 % Restlicht abgeben muss. Der "B-Wert" besagt, wie viele Lampen statistisch ausfallen dürfen: B50 = 50 %. Lichtfarbe [Kelvin]: "Warmes" (unter 3.300 Kelvin) oder "kaltes" (neutralweiß oder kaltweiß 3.300 – 5.300 Kelvin) Licht. LED-Licht ist umso energieeffizienter, je höher die Farbtemperatur ist. Abstrahlwinkel: Oft ist bei LED-Strahlern der Abstrahlwinkel kleiner als bei konventionellen Leuchten, ev. können mehr Leuchten erforderlich sein. Effektives "Thermomanagement" (Wärmeableitung): Etwa 65 – 80 % der von der LED aufgenommenen elektrischen Leistung wird in Wärme umgewandelt. Je höher die Chiptemperatur ist, desto geringer sind Lichtausbeute und Lebensdauer. Für einen wirt- schaftlichen Betrieb ist daher optimales Thermomanagement sehr wichtig. Lichtmanagement (gute Regelbarkeit): Lichtregelgeräte ermöglichen, mit der Steuerung der Ein- und Ausschaltzeitpunkte der Beleuchtungsanlage eine dem aktuellen Bedarf angepasste Beleuchtung (bedarfs- gerechtes Licht). Achtung: Nicht alle LEDs sind dimmbar. Farbwiedergabe: Der Farbwiedergabe-Index [Ra] drückt die Qualität der Farbwiedergabe aus, bester Wert ist 100. Im Außenbereich ist ein guter Farbwiedergabe-Index meist nicht so entscheidend. 8 Achten Sie beim Kauf von LEDs auf den Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten und deren Abstimmung aufeinander. Vergleichen Sie unter anderem diese Kriterien bei verschiedenen Anbietern: Worauf Sie beim Umstieg auf LEDs achten sollten Strom Licht W lm 180° 150° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 120° 90° 60° 30° 45 30 15 WARM WHITE 2.700 K 380 430 480 530 580 630 680 730 780 100 908070605040302010 0 Wellenlänge [nm] relative Xxxxxxxxxxxx [% ] LED Strom Licht W lm 180° 150° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 120° 90° 60° 30° 45 30 15 WARM WHITE 2.700 K 380 430 480 530 580 630 680 730 780 100 908070605040302010 0 Wellenlänge [nm] relative Xxxxxxxxxxxx [% ] LED Strom Licht W lm 180° 150° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 120° 90° 60° 30° 45 30 15 WARM WHITE 2.700 K 380 430 480 530 580 630 680 730 780 100 908070605040302010 0 Wellenlänge [nm] relative Xxxxxxxxxxxx [% ] LED Strom Licht W lm 180° 150° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 120° 90° 60° 30° 45 30 15 WARM WHITE 2.700 K 380 430 480 530 580 630 680 730 780 100 908070605040302010 0 Wellenlänge [nm] relative Xxxxxxxxxxxx [% ] LED Strom Licht W lm 180° 150° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 120° 90° 60° 30° 45 30 15 WARM WHITE 2.700 K 380 430 480 530 580 630 680 730 780 100 908070605040302010 0 Wellenlänge [nm] relative Xxxxxxxxxxxx [% ] LED Gradueller Lichtstromrückgang L 70 B 50 : Lebensdauer (h) nach der 50 % der LEDs noch 70 % Lichtstrom abgeben Quelle: Celma Leitfaden Abrupter Lichtstromrückgang L 0 C 10 : Lebensdauer (h) nach der 10 % der LEDs 0 % Lichtstrom abgeben 380 430 480 530 580 630 680 730 780 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Wellenlänge [nm] rela tiv e In tensitä t [%] LED Strom Licht W lm 180° 150° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 120° 90° 60° 30° 45 30 15 WARM WHITE 2.700 K 380 430 480 530 580 630 680 730 780 100 908070605040302010 0 Wellenlänge [nm] relative Xxxxxxxxxxxx [% ] LED
9 Vollständige technische Daten: Fordern Sie zusätzlich zu einer Lichtberechnung ein Datenblatt mit zumindest folgenden Punkten an: elektrische Leistung, Lichtausbeute, Lichtfarbe, Lebensdauer, Schaltbarkeit und Regel barkeit der Anlage, Montage anweisungen, Messzertifikat Überprüfung der Lichtpunkte: Es muss eine normgerechte Beleuchtung sichergestellt sein, vergleichen Sie die Beleuchtungsstärken vor und nach der Sanierung. Modularen Aufbau bevorzugen: Manche LED-Module bzw. Elektronikmodule können nicht vom Leuchtenkörper getrennt werden, damit müsste bei einem Defekt die gesamte Leuchte getauscht werden. Vermeidung von Blendung: Bedingt durch die kleine Lichtaustrittsfläche der LED tritt an dieser eine extrem hohe Leuchtdichte (bis zu über 10.000.000 cd/m 2 ) auf. Deshalb ist bei der Planung auf die Vermeidung allfälliger Blendung besonders zu achten. Streulicht: Durch die gezielte Lichtlenkung gibt es meist kaum Streulicht. Dies sollte in der Lichtplanung berücksichtigt werden (Abstrahlwinkel beachten). Ersatzteilbeschaffung: Im Gegensatz zu konventionellen Entladungslampen fehlt dzt. noch eine Normierung für das "Leuchtmittel LED" (Größe, Stecker, Befestigung, Vorschaltgeräte etc.). Entsprechende Normvorhaben sind derzeit sowohl auf europäischer wie auch internationaler Ebene in Arbeit. Aktuell ist beim Einsatz LED-basierter Leuchten jeden- falls die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für die geplante Nutzungsdauer sicherzustellen. Garantie: Es ist wichtig, Garantiezeit und Garantiebedingungen genau zu definieren. Lebensdauer: Die Wirtschaftlichkeit einer LED-Straßenbeleuchtung hängt stark von der effektiven Lebensdauer der gesamten Leuchte ab. Eine korrekte Berechnung kann erst gemacht werden, wenn diese Parameter bekannt sind. Retrofit-Lösungen: LED-Lampen mit Schraubsockel als Ersatz für herkömmliche Leuchtmittel in konventionellen Leuchten sind hin- sichtlich Lichtlenkung und Wärmeabfuhr zumeist problematisch. Die Vorteile der LED (wie gezielte Lichtlenkung, hohe Effizienz etc.) werden bei derartigen Lösungen nicht ausgenutzt. Tipps für die Planung
10 Wichtig für den niedrigen Stromverbrauch und das gute Funktionieren ist ein Zusammenspiel aller Komponen- ten der Beleuchtungsanlage, wozu im Wesentlichen Lichtquellen, Leuchten und Lichtmanagement zählen. 1. Lichtquellen Wichtige technische Komponenten Herzstück der Straßenbeleuchtung sind effiziente Lichtquellen. Waren bisher vor allem Natriumdampf-Hochdruck- lampen und Halogen-Metalldampflampen sowie Leuchtstofflampen im Einsatz, so wird nun bei einer Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorwiegend LED-Beleuchtung eingesetzt. Ein Grund für den raschen Wandel ist auch der europa- weite Ausstieg aus ineffizienten Beleuchtungslösungen, auch als "Ausphasen" bekannt. Ausphasen bedeutet, dass bestimmte Produktgruppen nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen. So werden zum Beispiel ab April 2015 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL-Lampen) und Natriumdampf-Hochdruck-Plug-in-Lampen ausgephast. 2. Leuchten Worauf ist bei effizienten Leuchten zu achten? Lichtstärkeverteilung: Beschreibt die räumliche Verteilung der Lichtstärke. An Hand der Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) kann die Form und Symmetrie der Lichtstärkeverteilung abgelesen werden. Der Anteil des Lichts, das bei optimal installierten Leuchten oberhalb der Horizontalen abgestrahlt wird, sollte auf die Werte lt. EU-Verordnung 245/2009 begrenzt werden. Leuchten-Betriebswirkungsgrad: Der Leuchten-Betriebswirkungsgrad beschreibt, wie effektiv eine Leuchte das Licht verteilt. Er besagt, wie viel Prozent des Lichtstroms der Lampen aus einer Leuchte austritt. Mit unterschiedlicher Lampenbestückung, Reflektoren und lichtlenkenden Elementen kann der Wirkungsgrad beeinflusst werden. Wartung: Die Wartungsfreundlichkeit der Leuchten ist ein wichtiges Entscheidungskriterium: einfaches Wechseln der Lichtquellen in großen Höhen hohe Lebensdauer geringe innere Verschmutzung der Leuchte durch hohe Schutzart (Abkapselung) Ausführung der Leuchten: Achten Sie auf gute Qualität, um die laufenden Betriebskosten niedrig halten zu können: tragende Teile der Leuchte aus korrosionsgeschütztem Metall (längere Lebensdauer) Gehäuse aus Aluminium-Druckguss ermöglichen eine höhere Schutzart und eine lange Lebensdauer Schutzart mind. IP 65 bietet einen verbesserten Schutz gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit verstellbare Lichtlenkoptik bzw. Linsentechniken ermöglicht das Lenken des Lichtes angepasst an den Aufstellungsort liegende Leuchtmittel ermöglichen eine hohe Gesamteffizienz der Leuchte Schutzklasse II gewährleistet die doppelte Isolierung spannungsführender Teile werkzeugloses Öffnen der Leuchte erleichtert die Instandhaltungsarbeiten Verfügbarkeit von Ersatzteilen automatische Unterbrechung der Spannungsversorgung beim Öffnen der Leuchte befugt auch "Laien" (Def. nach ÖNORM EN 50110) zum Tausch der Leuchtmittel ENEC Prüfzeichen (früher ÖVE-Prüfzeichen) CE-Kennzeichnung Das Zusammenspiel von Reflektor, Linsentechnik, Lichtquelle, Vorschaltgerät und Leuchtenabdeckung ist wichtig für Effizienz und Lichtqualität.
11 3. Lichtmanagement Moderne Beleuchtungstechnik sorgt dafür, dass das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge zur Verfügung steht. Mit einem intelligenten Lichtmanagementsystem kann eine effiziente, individuelle und bedarfsgerechte Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Fußgängerzonen oder Parkanlagen realisiert werden. Das Lichtmanagement erlaubt neben der aktiven Steuerung der Beleuchtungsanlagen auch die laufende Über- wachung der Betriebszustände, zum Beispiel Lampenausfälle und eine automatisierte Verbrauchserfassung. Damit wird ein kontinuierliches Energie-Monitoring möglich. Nachtabsenkung & Dimmung Eine Nachtabsenkung bzw. Dimmung oder reduzierte Beleuchtung in wenig befahrenen Zeiten steht nicht grundsätzlich im Widerspruch zur normgerechten Beleuchtung und ist in der ÖNORM O 1053 geregelt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der reduzierten Beleuchtung in den Nachtstunden. Ein Abschalten von einzelnen Leuchten verändert die Gleichmäßigkeit des Beleuchtungniveaus wesentlich und ist nicht normgemäß. Spannungsabsenkung: Im Verteiler wird ein Regelgerät eingebaut, das die Spannung während der Teilnachtschaltung im ganzen Versorgungszweig reduziert. Bei den einzelnen Straßenleuchten ist kein Eingriff notwendig. Werden Systeme eingesetzt, die die Versorgungsspannung reduzieren, sollte darauf geachtet werden, dass die Beleuchtung nicht den Wartungswert unterschreitet. Die Spannungsreduktion muss auf die letzte Leuchte abgestimmt sein. Lichtregelgeräte: Mittels Lichtregelgeräten kann die Straßenbeleuchtung flexibel an unterschiedliche Bedingungen angepasst werden. Licht kann auch je nach Tageszeit, Wetterlage oder Verkehrsaufkommen sensorgesteuert gedimmt werden.
12 Bedarfsorientierte Lichtregelung bei LEDs: LED können sehr gut mit bedarfsgerechter Steuerung betrieben werden. Dazu werden sie mit Sensoren kombi- niert. Ein Bewegungsmelder ist zum Beispiel ein Sensor, der Bewegungen erkennt und dadurch Signale an die Beleuchtung sendet. Die erhältlichen Systeme basieren auf unterschiedliche Techniken. PIR (passiv infrarot) Radar Optischer Sensor Eigenschaften Optimal für langsame Bewegungen und Objekte in der Nähe Entfernte und schnelle Objekte werden schlecht erfasst ( 50 km/h) Optimal für schnelle Bewegungen (fahrende Autos) Langsame Objekte werden schlecht erfasst ( 3 km/h) Optimal für Personenerkennung (Tiere werden ignoriert) Sehr zuverlässig für langsame Bewegungen Anwendung Fußwege Straßen mit Autos Rad- und Fußwege Quelle: www.energieeffizienz.ch Steuerung der einzelnen Leuchte: Bei der autarken Lichtsteuerung werden Steuereinheiten direkt in das Vorschaltgerät integriert. Dieses Verfahren ist preiswert, hat aber den Nachteil, dass defekte Regelstufen (Absenkung) nur bei einer Prüfung vor Ort erfasst und verändert werden können. Einfacher ist der Einsatz einer zentralen Steuerung. Beim Powerline-Verfahren werden die Signale über die vorhandenen Stromleitungen an die Leuchten gesendet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Steuersignale per Funk zu übertragen. Nicht alle Leuchten sind allerdings dafür geeignet. 1 Autarke Lichtsteuerung Steuerung wird an jeder Leuchte direkt programmiert Steuerung nur vor Ort möglich Keine automatische Meldung von Lampenausfällen 2 Lichtsteuerung über Powerline-Verfahren Das vorhandene Stromnetz wird zur Steuerung genutzt Automatische Meldung von Lampenausfällen möglich Steuerung von einem zentralen Ort aus 3 Lichtsteuerung über Funk Steuerungssignal wird per Funk übertragen Signalverstärker in den Leuchten erweitert das Netz Automatische Meldung von Lampenausfällen möglich Steuerung von einem zentralen Ort aus 1 2 3 Quelle: www.stromeffizienz.de
13 Ein Übermaß an Licht – durch Straßenbeleuchtung, durch das Anstrahlen von Gebäuden, durch Werbetafeln oder durch Effektbeleuchtung im Hausgarten – ist für den Naturhaushalt ein störender Faktor. Tiere haben ihren Lebensrhythmus der jeweiligen natürlichen Umgebungsbeleuchtung angepasst und Veränderungen der natürlichen Lichtverhältnisse durch künstliches Licht können somit ökologische Auswirkungen haben. Die Anziehungskraft einer Lichtquelle auf Insekten ist unterschiedlich. Diese hängt sehr vom Lichtspektrum der jeweiligen Lampe ab, das heißt, in welchen Wellenlängen die Lichtquelle strahlt. Die spektrale Empfindlichkeit der Tiere liegt meist im blauen und ultravioletten Bereich. Weißes Licht mit hohen blauen und ultravioletten Anteilen wird von Insekten als viel heller wahrgenommen als von Menschen. Auf die Wellenlängen des Lichts im violetten Bereich reagieren die Facettenaugen der Insekten äußerst empfindlich. Gleichzeitig üben diese die größte Anziehungskraft auf sie aus. Im gelben, orangefarbenen und roten Wellenlängenbereich sind Insekten- augen generell unempfindlicher. LED-Lampen sind relativ insektenfreundlich. Ihr Licht strahlt kaum in jenen Frequenzbereichen, für die Insektenaugen besonders empfindlich sind. Zudem locken LED weniger Insekten an, da sie kein Streulicht in die Umgebung ausstrahlen. Tipps zur Reduzierung des Einflusses der Beleuchtung auf den Naturhaushalt Licht- & Naturschutzaspekte Standard-Straßenleuchte trägt ebenfalls zur Lichtverschmutzung bei Abgeschirmte Leuchte geringste Lichtverschmutzung Kugelleuchte größte Lichtverschmutzung Details dazu finden Sie in der Broschüre des Landes Oberösterreich "Besseres Licht – Leitfaden" (www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/115999_DEU_HTML.htm) Wahl des Standortes der Beleuchtungsanlagen: ökologisch empfindliche Lebensräume wie z. B. Waldränder, Ufergebiete von Gewässern oder Wiesen sollten vom Lichtschein nicht erreicht werden. Randbereiche von Siedlungen sowie Übergänge zur freien Landschaft sollten – unter Wahrung von Sicherheitsan- forderungen für die Menschen – deutlich weniger ausgeleuchtet werden als zentrale Siedlungsbereiche und Hauptverkehrszonen. Licht soll möglichst direkt nach unten strahlen. Dies gilt auch für das Anstrahlen von historischen Gebäude- fassaden, Denkmälern und Brücken Auf die flächenhafte Ausleuchtung von Fassaden nach Möglichkeit verzichten Leuchten möglichst niedrig installieren Insektendichte Leuchtengehäuse verwenden Beleuchtungsanlagen nur zu den erforderlichen Zeiten betreiben, jahres- und tageszeitabhängige Schaltungen nutzen
14 Wirtschaftlichkeit von LEDs in der Straßenbeleuchtung LEDs erreichen derzeit schon eine ähnliche Effizienz wie Natriumdampf-Hochdrucklampen oder Halogen-Metall- dampflampen. Eine nennenswerte Energieeinsparung durch Wechsel auf LED ist hier nur bei entsprechend effektivem Betrieb der LED (Lichtlenkung, Dimmung etc.) zu erzielen. Anders verhält es sich beim Wechsel von Quecksilberdampf-Hochdrucklampen auf LED, hier ist eine deutliche Effizienzsteigerung erreichbar. Bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sollten die gesamten Lebenszyklus-Kosten verglichen werden. Den erhöhten Anschaffungskosten einer LED-Beleuchtung stehen die lange Lebensdauer und der geringe Wartungs- aufwand über die Lebensdauer betrachtet gegenüber. Finanzierung der Investition durch Einsparung Soll der Ersatz einer bestehenden Leuchte ausschließlich über die Energieeinsparung finanziert werden, kann unter Zugrundelegung folgender Rahmenbedingungen (Strompreis von 15 ct/kWh, 4 % jährliche Verzinsung), bezogen auf die Lebensdauer der LED von 50.000 Stunden (entspricht bei einer Brenndauer von 4.100 h/Jahr ca. 12 Jahren) von folgender Faustformel ausgegangen werden: Pro Kilowattstunde (kWh) Einsparung können ca. 1,41 Euro investiert werden. Das bedeutet, jede jährlich eingesparte Kilowattstunde bringt, hochgerechnet auf die typische Lebensdauer der LED (12 Jahre bei 4.100 h/Jahr), eine finanzielle Ersparnis von ca. 1,41 Euro (alle Beträge inkl. USt.). Diese Berech- nung geht von einem konstanten Strompreis aus (werden Verzinsung und Strompreissteigerung gleichgesetzt, liegt der Wert bei 1,8 Euro). Quelle: LTG Wirtschaftlichkeit & Finanzierung Beispiel Bei einem Lichtpunkt mit einer alten, unwirtschaftlichen 80 W Quecksilberdampf-Hochdrucklampe (Systemleistung ca. 90 W) wird, unter Beibehaltung der bisherigen Beleuchtungsqualität, die komplette Leuchte durch eine LED-Leuchte mit einer Systemleistung von 24 W ersetzt: Die Energieeinsparung beträgt bei 4.100 Brennstunden 270 kWh pro Jahr. Entsprechend der Faustformel ergibt sich daraus innerhalb von 12 Jahren eine finanzielle Einsparung von 380 Euro. Dieser Betrag steht somit – unter der Voraussetzung eines 1:1 Leuchtentausches – bei ausschließlicher Finanzierung durch die Energieeinsparung, für Investitionen (pro Leuchte) zur Verfügung. Zudem können eingesparte Wartungskosten, die manchmal beträchtlich sein können, und die CO 2 -Reduktion mitbedacht werden. Bei steigenden Strompreisen steigt die Einsparung. Quelle: LTG, LED Revolution in der Lichttechnik?
15 Abschätzung der Einsparungen Um die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen abzuschätzen und sich einen Überblick über die möglichen Einsparungen (Leistung, Stromverbrauch, Wartungskosten) zu verschaffen, kann man folgende Tabelle ausfüllen: Fördermöglichkeiten für effiziente Straßenbeleuchtung Investitionsförderungen: Informieren Sie sich über die aktuellen Möglichkeiten im Rahmen der Bundesförderung ("Klimaschutz in Gemein- den", betriebliche Förderungen) sowie über mögliche Förderungen des Landes (Landesumweltförderung). Energie-Contracting-Programm des Landes OÖ Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses für das Finanzierungsinstrument Contracting. Die Höhe ist von der Contracting-Laufzeit abhängig. Die geförderte Contracting-Laufzeit berücksichtigt max. 10 Jahre. Das förder- bare Investitionsvolumen muss mind. 50.000 Euro betragen und ist mit 250.000 Euro begrenzt. Der maximale Fördersatz bezogen auf die Bemessungsgrundlage (das ist die mittels Einsparung refinanzierte Investition) beträgt 20 %. Details siehe www.energiesparverband.at Folgende Mindestinhalte sollten in einem Einspar-Contracting-Vertrag enthalten sein: Klare und transparente Aufstellung der durchzuführenden Effizienzmaßnahmen Auflistung der zur Durchführung der Maßnahmen zu unternehmenden Schritte und dazugehörige Kosten Die durch die Umsetzung der Vertragsmaßnahmen zu erzielende garantierte Einsparungen Transparente Berechnung der "Baseline" (zB Einschaltzeiten, dzt. Energie- und Wartungskosten, Beleuchtungsniveau, etc.) Eindeutige Regelung der Vertragslaufzeit Für die Ermittlung der erzielten Einsparungen maßgebliche(s) Datum/Daten Vorgangsweise bei der Ermittlung und Überprüfung der garantierten Einsparung und Konsequenzen bei Nichterreichung Berechnung der Contractingrate und Aufteilung der erzielten monetären Einsparungen; Abrechnungsmodus Regelung für die Instandhaltung und Wartung Regelungen zum Umgang mit sich ändernden Rahmenbedingungen, die den Vertragsinhalt berühren (z.B. sich ändernde Energiepreise, Einschaltzeiten, Erweiterungen). Detaillierte Informationen zu den Verpflichtungen/Aufgabenteilung jeder Vertragspartei Beispiel einer oö. Gemeinde Anzahl der Lichtpunkte Stück Installierte Leistung vor der Sanierung kW Installierte Leistung nach der Sanierung kW Stromverbrauch vor der Sanierung kWh Stromverbrauch nach der Sanierung kWh = Jährliche Stromeinsparung kWh % Stromkosten vor der Sanierung Euro Stromkosten nach der Sanierung Euro = Jährliche Stromkosteneinsparung Euro % Wartungskosten vor der Sanierung Euro Wartungskosten nach der Sanierung Euro = Jährliche Einsparung Wartungskosten Euro % Anzahl der Lichtpunkte 267 Stück Installierte Leistung vor der Sanierung 17 kW Installierte Leistung nach der Sanierung 6 kW Stromverbrauch vor der Sanierung 72.198 kWh Stromverbrauch nach der Sanierung 34.752 kWh = Jährliche Stromeinsparung –37.446 kWh –51,9 % Stromkosten vor der Sanierung 12.996 Euro Stromkosten nach der Sanierung 6.255 Euro = Jährliche Stromkosteneinsparung –6.741 Euro –51,9 % Wartungskosten vor der Sanierung 7.369 Euro Wartungskosten nach der Sanierung 3.829 Euro = Jährliche Einsparung Wartungskosten –3.540 Euro –48 %
16 Sanierung von Straßenbeleuchtung ohne Investitionsmittel finanzieren und umsetzen! Energie-Contracting Was bedeutet….? Contractor: spezialisiertes Unternehmen, das die Dienstleistung Contracting anbietetContracting-Nehmer: eine Gemeinde (oder ein Betrieb), in dessen Bereich ein Contracting-Projekt auf Basis eines Contracting-Vertrages durchgeführt wirdContracting-Vertrag: Fundament für jedes erfolgreiche Contracting-Projekt, regelt die Zusammenarbeit zwischen Contractor und Contracting-NehmerBaseline: Referenzwert, der aus jenen Energiekosten und -verbräuchen ermittelt wird, die in einem Referenz- zeitraum (z.B. die letzten 3 Jahre) angefallen sindVertragslaufzeit: Zeitrahmen der Inanspruchnahme der LeistungRefinanzierung der Investition: durch die erzielte Energie einsparung (Einspar-Contracting)Garantien: Garantien für die qualitative Durchführung der Arbeiten durch den Contractor (z.B. Mindest- einsparung, Funktionsfähigkeit der Anlage) Was bringt Contracting einer Gemeinde? Erfolgsgarantie: der Contractor verpflichtet sich, eine Mindesteinsparung bzw. planbare Energiekosten zu erzielen. Kapital bleibt in der Gemeinde und muss nicht investiert werden, die erzielten Energieeinsparungen kommen – nach Refinanzierung der Investitionen – der Gemeinde zu Gute. Die Gemeinde hat den "Imagegewinn" der modernen Straßenbeleuchtung. Arbeitszeit der Mitarbeiter/innen steht für andere Aufgaben zur Verfügung Durch das Contracting profitieren alle: die Gemeinde, der Contractor und die Umwelt. Daher gibt es auch in Oberösterreich zur Forcierung von Contracting mit dem Energie-Contracting-Programm des Landes ein spezielles Förderprogramm. Beim sogenannten Contracting tätigt ein spezialisiertes Unternehmen (= Contractor) Energie-Investitionen in ei- ner Gemeinde oder einem Unternehmen (= Contracting- Nehmer). Beim Einspar-Contracting, zu dem auch das Straßenbeleuchtungs-Contracting zählt, geht es um die energetische Sanierung. Daneben gibt es auch noch das Anlagen-Contracting, das zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie dient. Beim Einspar-Contracting führt der Contractor Energie- spar-Maßnahmen durch (z. B. effiziente Beleuchtung), die zu geringeren Energiekosten führen. Aus den erzielten Einsparungen werden die Investitionskosten des Con- tractors refinanziert. Ener giek osten Vertragsbeginn Vertragsende Zeit Refinanzierung der Investition Energiekosten- Einsparung bisherige Ener giek osten neue Ener giek osten Ener giek osten
17 Häufige Fragen rund um Energie-Contracting Ist Einspar-Contracting bei jeder Straßenbeleuchtung möglich? Prinzipiell lassen sich bei fast jeder Straßenbeleuch- tung, die einige Jahre alt ist, technisch und wirt- schaftlich erschließbare Einsparpotenziale finden. Bei kurzen Straßenzügen mit wenig Leuchten bzw. geringen Energiekosten ist ein Zusammenschluss mit anderen Straßenzügen zu einem Pool sinnvoll. Welche Maßnahmen werden in Straßen- beleuchtungs-Contracting-Projekten umgesetzt? Sanierung vorhandener Anlagen, neue Regelung, Austausch von Lampen, komplette Erneuerung der Leuchten, Sanierung der Masten. Eine Erweiterung der Straßenbeleuchtung kann in das Projekt mitauf- genommen werden (allerdings nicht durch Einsparung finanziert werden). Wann ist ein Energie-Contracting-Projekt weniger sinnvoll? Ob die Umsetzung von Energieinvestitionen ohne Contracting vorteilhafter ist, hängt u.a. von folgenden Faktoren ab: von der Größe des Projekts von vorhandenen Investitionsmitteln und Personal kapazitäten von Einkaufskonditionen für Lampen und Leuchten Wie finde ich einen geeigneten Contractor? Eine Liste von Contractoren, die bereits geförderte Contracting-Projekte in Oberösterreich abgewickelt haben, findet sich auf www.energiesparverband.at. Wer trägt welches Risiko? Der Contractor trägt das technische und finanzielle Risiko der erfolgreichen Projekt-Umsetzung. Damit der Contracting-Nehmer keinen Schaden aus wirt- schaftlichen Problemen des Contractors nimmt, empfiehlt es sich, diesbezügliche Vorkehrungen im Contracting-Vertrag zu treffen. Welche Auswirkung hat das Contracting-Projekt auf das Personal? Ein erfahrener Contractor ist interessiert, das vor- handene Personal (z.B. Techniker in der Gemeinde) einzubinden und dadurch die optimale Betreuung der Anlagen vor Ort sicherzustellen. Durch das Contracting-Projekt können sich für das Personal neue Aufgaben, wie Erhebung von Energie daten, Überprüfung der Qualität und Umsetzung der Maßnahmen, sowie die Überprüfung der jährlichen Abrechnungen ergeben. Wie (zeit-)aufwändig ist ein Contracting-Projekt für den Contracting-Nehmer? Die erfolgreiche Umsetzung eines Contracting-Projekts hängt entscheidend von der sorgfältigen Projektvorbe- reitung ab. Zu Beginn sollten alle Beteiligten einbezogen werden, um so Transparenz und Akzeptanz zu gewähr- leisten. Gute Planung des Projektes und klare Vorgaben (Qualitätskriterien) an den Contractor sind erforderlich. Wie werden die Referenzkosten (Baseline) ermittelt? Die Basis für die Berechnung des Entgelts des Contractors bildet die "Baseline". Um zu verhindern, dass sich Faktoren, die der Contractor nicht beeinflussen kann (z.B. Energie- preise und Nutzungsänderung) zu seinen Gunsten oder Ungunsten auswirken, werden die Energiekosten bzw. der Energieverbrauch mit den Werten des Referenzjahres verglichen. Ab wann profitiert der Contracting-Nehmer von den Energieeinsparungen? Je nach Vereinbarung kann der Contracting-Nehmer entweder gleich zu Projektbeginn von den niedrigeren Energiekosten profitieren (muss dafür allerdings eine längere Vertragslaufzeit in Kauf nehmen) oder erst nach Vertragsende. Um welches Investitionsvolumen geht es? Ein Mindest investitionsvolumen von 50.000 Euro wird empfohlen (ECP-Förderung). Können mit dem Contracting-Projekt auch andere Maßnahmen wie die Beleuchtung eines neuen Straßenzuges umgesetzt werden? Ja, dies bringt den Vorteil der professionellen Umsetzung der Maßnahmen durch den Contractor. Allerdings ist dann in der Regel eine Anzahlung erforderlich, da nur solche Investitionen über Contracting finanziert werden können, die zu Energieeinsparungen führen. Was passiert nach Ende der Vertragslaufzeit? Mit Ende der Vertragslaufzeit kann der Contracting- Nehmer die Aufgaben des Contractors wieder selbst über- nehmen und profitiert allein von den niedrigeren Ener- giekosten. Selbstverständlich kann der Vertrag aber auch verlängert oder abgeändert fortgeführt werden.
18 Beispiel Altheim Ein Vorreiter der LED-Straßenbeleuchtung Technische Daten Lichtfarbe: neutralweiß (4.000 K) Anschlussleistungen: 28 Watt, Halbnacht- absenkung 14 Watt Lichtausbeute: 107 lm/W Lebensdauer: 50.000 h, 10 Jahre Garantie Investitionskosten: bisher 315.000 Euro Altheim im Bezirk Braunau am Inn ist im Energie- bereich bekannt für die Nutzung der Geothermie. Im Bereich der Straßenbeleuchtung suchte die Stadtge- meinde aktiv nach einer energie-eff izienten Lösung. Bei der Neuerrichtung einer Gehwegbeleuchtung woll- te man in der Gemeinde Altheim eine Alternative zur den angebotenen Natriumdampflampen. LEDs für die Straßenbeleuchtung waren 2008 noch wenig bekannt und die Stadtgemeinde musste sich bemühen, auch Angebote zu bekommen. Nach der Installation von 3 LED-Musterleuchten auf bestehenden Beleuchtungs- masten und auf Basis einer Ausschreibung entschloss sich die Stadt gemeinde für die LED-Technologie. In einem ersten Schritt wurden rund 100 LED-Licht- punkte an Gehsteigen entlang der Hauptzufahrts- straße, in einzelnen Siedlungsstraßen und auf einem Parkplatz installiert. Zusätzlich wurde auch eine Halb- nachtschaltung umgesetzt. Die Leistungsaufnahme während der Nachtstunden (22.30 bis 5.00 Uhr) kann dadurch halbiert werden. In Altheim ist man von der LED-Straßenbeleuchtung überzeugt. So wurden in den letzten Jahren weitere 125 Lichtpunkte auf LED umgestellt. Bei Erweiterungen der Straßenbeleuchtung setzte die Gemeinde ebenfalls auf LED-Technologie. Im Jahr 2015 wird die Sanierung der bestehenden Straßenbeleuchtung fortgesetzt, die Um- rüstung von 50 weiteren Lichtpunkten ist vorgesehen.
19 Beispiel Gaspoltshofen Weniger Strom bei besserem Licht Die Marktgemeinde Gaspoltshofen mit 3.500 Einwoh- nern liegt im Bezirk Grieskirchen im Hausruckviertel. Die Gemeinde setzte sich bei der Erstellung des loka- len Energiekonzeptes im Jahr 2012 das Ziel, den Strom- verbrauch der Kommune um 30 % zu senken. Neben der Optimierung der Pumpentechnik in den Abwas- seranlagen und der Umstellung auf energie-effiziente Bürotechnik soll die Sanierung der Straßenbeleuch- tung wesentlich zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Teile der alten Straßenbeleuchtung der Marktgemein- de Gaspoltshofen waren bis zu 35 Jahre alt. Neben den hohen Stromkosten waren vor allem die hohen War- tungskosten ein Problem. Entlang der Landesstraße B135 wurde bereits mit der Umstellung auf effiziente LED-Technik begonnen, weshalb die Gemeinde be- schloss, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und auch die weitere Straßenbeleuchtung auf diese inno- vative Technik umzustellen. 172 von 273 Lichtpunkten wurden im Zuge der des Contractingprojekts saniert. Je nach Alter und Art der vorhandenen Technik wurden die Lichtpunkte erneuert oder auf LED bzw. Halogen- Metalldampflampen umgerüstet. Die Sanierungs- maßnahmen ermöglichen eine vertraglich garantierte Energiekosten-Einsparung von 36 %. Ende 2013 ging die neue Anlage in Betrieb. Die neue Technik konnte bereits jetzt durch die verbesserte Licht- qualität überzeugen: "Das Licht ist jetzt dort, wo es be- nötigt wird, und nicht im Wohnzimmer der Anwohner." Technische Daten Anzahl der sanierten Lichtpunkte: 172 (63 % der Straßenbeleuchtung) Anschlussleistungen: 19 bis 120 W Lichtfarbe: 4.000 bis 5.000 K 6.000 K (Flutlichtstrahler für Kirchenanstrahlung) Lichtausbeute, Beispiele: 103 lm/W (Aufsatzleuchte Teceo 27 W LED) 107 lm/W (Aufsatzleuchte Teceo 19 W LED) 75 lm/W (LED-Flutlichtstrahler für Kirchen- anstrahlung 120 W) Inbetriebnahme: Dezember 2013 Wirtschaftlichkeit Vertragliche garantierte Einsparungen: - Strom: 38.000 kWh/a (= 36 %) - Stromkosten: 5.600 Euro/a - Wartung: 7.500 Euro/a Gesamt-Investitionskosten: 130.000 Euro Contractor: Illumina - Licht & Service GmbH
20 Beispiel Kremsmünster Hauptstraße als "LED-Teststrecke" Die elektrische Straßenbeleuchtung in Kremsmünster geht auf das Jahr 1910 zurück und wurde mit einem Freudenfest am Geburtstag von Kaiser Franz Josef in Betrieb genommen. Seither wurde die Beleuchtung ständig erweitert und erneuert, die Verkabelung stammt jedoch teilweise noch aus den 50er Jahren. 2009 entschloss sich die Marktgemeinde Krems- münster, die Straßenbeleuchtung auf der Hauptstraße und auf dem Marktplatz sowie die Weihnachtsbe- leuchtung auf LED-Technologie umzurüsten. Der Hauptbeweggrund war der Wunsch nach einer Ver- besserung der Beleuchtungssituation. Mit der Be- leuchtung der Hauptstraße wurde der Einsatz von LED-Leuchten getestet und Reaktionen der Bürger/ innen auf die Lichtfarbe konnten gesammelt werden. Im Anschluss daran wurden 2010 in einem ersten Projekt 12 Leuchten mit Quecksilberdampf-Hoch- druck-Lampen mit einer Lampenleistung von 80 Watt durch 14 LED-Leuchten je 30 Watt ersetzt. Durch den Leuchtentausch kam es zu einer spürbaren Beleuch- tungsverbesserung bei einer Stromeinsparung von 20 %. 2013 stellte die Gemeinde im Rahmen eines Contracting-Projekts einen Großteil der Straßenbe- leuchtung auf LED-Technologie um. Durch die Sanie- rungsmaßnahmen sinken die jährlichen Stromkosten um 53,5 %. Aufgrund der 5-jährigen Vollgarantie und der hohen Lebensdauer der LED-Lampen sind bei den Wartungskosten Einsparungen vom 17.700 Euro jähr- lich möglich. Technische Daten Anzahl der sanierten Lichtpunkte: ca. 700 (93 % der Straßenbeleuchtung) Gesamt-Anschlussleistung: 22 kW bei 100 % Nachtabsenkung: 15 kW (zwischen 80 % und 50 %) Lichtfarbe: 4.000 bis 5.000 K Lichtausbeute: 81 lm/W Lebensdauer: 50.000 h Umsetzungszeitraum: 2013 Wirtschaftlichkeit Vertragliche garantierte Einsparungen: - Strom: 146.000 kWh (53,5 %) - Stromkosten: 23.100 Euro - Wartung: 17.700 Euro Gesamt-Investitionskosten: 770.000 Euro Contractor: eww ag
21 Mauthausen an der Donau liegt am Kreuzungspunkt zweier alter Handelswege und war lange Zeit eine wichtige Mautstelle. Viele Gebäude erinnern noch an den ehemaligen Handelsmarkt, die Straßenbeleuch- tung ist jedoch hochmodern. Im Jahr 2011 stellte die Marktgemeinde die gesam- te Straßen beleuchtung (460 Lichtpunkte) auf LED- Technologie um. Die alte Straßenbeleuchtung mit Quecksilberdampflampen war zum Großteil über 20 Jahre alt und unwirtschaftlich. Nach einer Fein- analyse und der Installation einer Musterstraße, die sowohl mit konventionellen Leuchtmitteln als auch mit LED-Modulen bestückt wurde, entschied sich der Gemeindeausschuss für die LED-Variante. Bei der Sanierung wurden rund 460 Lichtpunkte er- neuert, Kofferleuchten mit 80 Watt Lampenleistung wurden durch LED-Ansatzleuchten zu 51 Watt und Kandelaber-Leuchten mit 72 Watt (4 x 18) durch LED- Aufsatzleuchten zu 13 Watt getauscht. Im Zuge der Straßenbeleuchtungssanierung wurden Schaltstellen repariert bzw. komplett erneuert, Kabelfehler geortet und behoben und ein Beleuchtungskonzept für die jeweilige Straßengeometrie erstellt. Die ersten Betriebsjahre der sanierten Straßen- beleuchtung zeigten, dass anstelle der prognostizier- ten 36 % Energieeinsparung sogar fast 50 % (100.000 kWh/a) erreicht werden, wodurch sich die Amortisationszeit um 1 bis 1,5 Jahre verkürzt. Beispiel Mauthausen Gesamtsanierung der Straßenbeleuchtung Technische Daten Lichtfarbe: warmweiß (3.000K) und neutral- weiß (4.000K) Anschlussleistungen: 51 Watt bzw. 13 Watt Beleuchtungsstärke: 3 lux (Siedlungsstraße) Lebensdauer: 60.000 h, 12 Jahre Wirtschaftlichkeit Jahresstromverbrauch (vorher): 240.000 kWh Einsparungen pro Jahr: - Strom: 86.000 kWh (36 %), - Stromkosten: 15.000 Euro, - Wartungskosten: 5.900 Euro Investitionskosten: 400.000 Euro Amortisationsdauer: 16 Jahre Energiedienstleister: Linz AG
22 Beispiel Peuerbach Moderne Technologie in historischer Optik Die Stadt Peuerbach ist eine 2.200-Einwohner-Stadt im Hausruckviertel, bekannt für den Silvesterlauf und die oberösterreichische Landeskrippe. Setzt die Ge- meinde in diesen Bereichen auf Tradition, so war bei der Straßenbeleuchtung Erneuerung das Ziel. Die Beleuchtung der Stadtgemeinde war teilweise zwi- schen 40 und 50 Jahre alt. Hohe Wartungs- und Ener- giekosten und schlechte Lichtqualität waren die Folge. Nach einer energetischen Feinanalyse fiel die Ent- scheidung für eine Gesamtsanierung der Straßen- beleuchtung basierend auf LED-Technik. Neben Energiekosten-Einsparung und Verbesserung der Lichtlenkung war den Verantwortlichen vor allem die Senkung der Wartungskosten wichtig. 311 Lichtpunk- te wurden saniert. Großteils wurden die veralteten Leuchten durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Bei der Altstadtbeleuchtung wurde jedoch auf den Erhalt der historischen Optik Wert gelegt, weshalb die dort verwendeten Kandelaber auf LED-Technik umgerüs- tet wurden. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden die GPS- Daten aller Lichtpunkt in die digitale Katastralmappe der Gemeinde aufgenommen. Mit diesem positiven Nebeneffekt, der vertraglichen Einspargarantie von 64 % und der Begeisterung in der Gemeinde über die deutlich verbesserte Lichtqualität kann das Sanie- rungsprojekt schon jetzt als Erfolg gewertet werden. Technische Daten Anzahl der sanierten Lichtpunkte: 311 (ca. 75 % der Straßenbeleuchtung) Anschlussleistungen: 26 bis 55 W Lichtfarbe: 4.000 bis 4.100 K Lichtausbeute, Beispiele: 84 bis 122 lm/Watt Lebensdauer: 70.000 bis 80.000 h (laut Herstellerangaben) Inbetriebnahme: Februar 2014 Wirtschaftlichkeit Vertragliche garantierte Einsparungen: - Strom: 99.500 kWh/a (= 64 %) - Stromkosten: 15.000 Euro/a - Wartung: 7.800 Euro/a Gesamt-Investitionskosten: 240.000 Euro Contractor: ELIN GmbH & Co KG
23 Beispiel Rohrbach Von Energie-Contracting überzeugt Energiesparen spielte in Rohrbach schon immer eine wichtige Rolle. Das Schul- und Verwaltungszentrum des oberen Mühlviertels ist bereits 1999 dem Klima- bündis beigetreten und war die erste Bezirkshaupt- stadt, die gemeinsam mit dem OÖ Energiesparver- band ein Bezirks-Energiekonzept entwickelte. Schon im Jahr 2002 setzte Rohrbach auch bei der Straßenbeleuchtung auf Energie-Effizienz. Die Stadt sanierte die veraltete und von Ausfällen betroffene Straßenbeleuchtung im Rahmen eines Contracting- Projekts und erzielte damals Energiekosten-Einspa- rungen von 34 %. Nach der 10-jährigen Vertragslaufzeit entschied sich die Gemeinde, den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung weiter zu reduzieren. Die gelb- leuchtenden Natriumdampf-Hochdrucklampen aus dem Jahr 2002 wurden überall dort, wo es technisch sinnvoll war, durch "weiße" LED-Lampen ersetzt. Die Sanierung von 79 % der insgesamt 419 Lichtpunkte macht vertraglich garantierte Energieeinsparungen von weiteren 53 % möglich. In einzelnen Straßenzü- gen wird dieser Wert mit Einsparungen bis zu ca. 70 % noch deutlich übertroffen. Die Stadtgemeinde Rohrbach führte beide Projekte mit demselben Contractor durch und ist von den Vor- teilen dieser Finanzierungform überzeugt. Contrac- ting ermöglicht ambitionierte Energie-Einsparpro- jekte, weiters profitierte die Stadt Rohrbach von der professionellen Projektplanung und Abwicklung. Technische Daten Anzahl der sanierten Lichtpunkte: 329 (79 % der Straßenbeleuchtung) Gesamt-Anschlussleistung: 24 kW bei 100 % Nachtabsenkung: 14 kW (bei 50 %) Lichtfarbe: 4.000 K Lichtausbeute: 65 lm/W Lebensdauer: 50.000 h Jahr der Umsetzung: 2012 Wirtschaftlichkeit Vertragliche garantierte Einsparungen: - Strom: 83.500 kWh/a (= 53 %) - Stromkosten: 10.400 Euro/a - Wartung: 2.400 Euro/a Gesamt-Investitionskosten: 110.000 Euro Contractor: eww ag
24 Beispiel Thalheim bei Wels Eine engagierte Gemeinde setzt auf LED Die 6.000-Einwohner-Gemeinde Thalheim bei Wels ist seit 2009 EGEM-Gemeinde und in Umwelt- und Energiefragen schon seit längerem besonders enga- giert. 2009 setzte sich die Marktgemeinde Thalheim die Stabilisierung des Stromverbrauchs als strategisches Ziel. Um dies zu erreichen, beschloss der Gemeinde- rat die veraltete Straßenbeleuchtung, die mehr als 40 % des kommunalen Stromverbrauchs verursach- te, auf innovative LED-Technologie umzurüsten. Von November 2012 bis April 2013 wurden 465 Lichtpunkte saniert, das sind ca. 50 % der gesamten Straßenbe- leuchtung. Je nach Zustand der Lichtpunkte wurden die Leuchten komplett ersetzt oder durch Umrüstung auf den Stand der Technik gebracht. In den sanierten Anlagenteilen wurde dadurch die Anschlussleistung von 39 kW auf 14 kW reduziert, was eine vertraglich garantierte Energieeinsparung von 68 % ermöglicht. Zusätzlich zur Stromkostensenkung spart sich die Ge- meinde aufgrund der Langlebigkeit der LED-Lampen und der 10-Jahres-Garantie jährliche Wartungskosten von ca. 4.300 Euro. Technische Daten Anzahl der sanierten Lichtpunkte: 465 (ca. 50 % der Straßenbeleuchtung) Anschlussleistungen: 18 bis 83 W Lichtfarbe: Neutralweiß (4.000 bzw. 4.200 K) Lichtausbeute: 68 bis 108 lm/W Lebensdauer: 70.000 h, 10 Jahre Garantie Umsetzungszeitraum: November 2012 bis April 2013 Wirtschaftlichkeit Vertragliche garantierte Einsparungen: - Strom: 109.900 kWh/a (= 68 % in den sanierten Anlagenteilen) - Stromkosten: 17.400 Euro/a - Wartung: 4.300 Euro/a Gesamt-Investitionskosten: 320.000 Euro Contractor: eww ag
25 Beispiel Wels Ein LED-Großprojekt Die Messestadt Wels, die jährlich 100.000 Besucher/ innen auf der Energiesparmesse verzeichnet, setzt auch bei der Straßenbeleuchtung auf Energie-Eff izi- enz. In einem umfassenden Sanierungsprojekt wur- den 50 % der Straßenbeleuchtung auf LED-Techno- logie umgerüstet. Die Straßenbeleuchtung in Wels umfasst insgesamt rund 7.700 Leuchten mit 9.100 Lichtpunkten. Vor der Sanierung 2011 waren Lampen mit älterer Technologie wie Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL), Nat- riumdampflampen, Plug-in-Lösungen und Leucht- stofflampen im Einsatz. Bei der Umrüstung wurden alle Lampen, die älter als 15 Jahre und daher am ineffi- zientesten waren, ausgetauscht. Das Projekt erstreckt sich auf das gesamte Stadtgebiet und deckt sowohl Bundesstraßen als auch Siedlungsgebiete und Fuß- gängerzonen ab. Auf den höherrangigen Straßen wurde der gesam- te Leuchtenkopf getauscht, in den Wohngegenden wurde, wenn möglich, das vorhandene Modell (wie z. B. Auris-Kugelleuchten) weiterverwendet und mit einem LED-Einsatz ausgestattet. Für Leuchten, wo ein LED-Einsatz nicht möglich war, wurde die "Wels- Leuchte" entwickelt. Die Regelung wurde ebenfalls modernisiert. Schaltverteiler wurden dem Stand der Technik angepasst und mit Energiemanagementgerä- ten nachgerüstet. Ein Drittel der Straßen beleuchtung wird von 21.30 Uhr bis 5.30 Uhr auf 50 % abgesenkt. Technische Daten Lichtfarbe: neutralweiß (4.000 K) Anschlussleistungen: 30 - 90 Watt Beleuchtungsstärke: 3 Lux (Wohngegenden), 7 - 10 Lux (Nebenstraßen), 15 Lux (Bundesstraßen) Lichtausbeute: 78 lm/W Lebensdauer: 40.000 bis 70.000 h, 10 Jahre Garantie Wirtschaftlichkeit Jahresstromverbrauch (vorher): 3,5 Mio. kWh Einsparungen pro Jahr: - Strom: 1,2 Mio. kWh (= 36 %) - Stromkosten: 230.000 Euro, - Wartungskosten: 60.000 Euro Investitionskosten: 2.100.000 Euro Amortisationsdauer: 7 Jahre Contracting-Projekt, Contractor: eww ag
26 Was ist normgerechte Beleuchtung? Die Verpflichtung zum Betrieb einer Straßenbeleuchtung ist nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt sondern wird vielmehr aus verschiedenen rechtlichen Normen und aus der Rechtsprechung abgeleitet, z. B. Verkehrs- sicherungspflicht gem. §1295 ABGB, Wegehalterhaftung gem. §1319a ABGB, Bauwerkhaftung gem. §1319 ABGB, Straßenverkehrsordnung (§§ 32, 89, 90 StVO). In Bezug auf die Straßenbeleuchtung haftet der Besitzer – sofern er den Betrieb nicht an Fachunternehmen auslagert – auch für die elektrotechnische Sicherheit, insbesondere die Funktion der Schutzmaßnahmen. Wiederkehrende Prüfungen sind erforderlich und ein Anlagenbuch ist zu führen, Details siehe Elektroschutz- verordnung. Neben den gesetzlichen Vorgaben sind Normen zu beachten. Sie repräsentieren den Stand der Technik. Nachdem womöglich Haftungsansprüche aufgrund unzureichender Beleuchtung bei Unfällen, Straftaten etc. geltend gemacht werden könnten, ist die Einhaltung der entsprechenden Normen zu empfehlen. Damit die Straßenbeleuchtung normgerecht ausgeführt werden kann, sind vom Beleuchtungsplaner die Beleuchtungsklassen entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten auszuwählen. Entsprechend der Einordnung in verschiedene Klassen kann dann die erforderliche Beleuchtungsstärke lt. Norm festgestellt werden. Besonders zu beachten sind die erhöhten Beleuchtungsanforderungen von Konfliktzonen (z. B. bei Schutz- wegen), geregelt in der ÖNORM O 1051. Planungsgrundlagen Wichtige Normen und gesetzliche Vorgaben (ÖNORM) EN 13201 "Straßenbeleuchtung, Teil 1-4": ist die europäische Norm zur "Straßenbeleuchtung". Sie gibt Empfehlungen zur Planung von Straßen- beleuchtungsanlagen und liefert Grundparameter für die Festlegung der Beleuchtungsklassen (Geschwindigkeit der Hauptnutzer, Nutzertypen, Wetter). Teil 1: Auswahl der Beleuchtungsklassen, Teil 2: Gütemerkmale, Teil 3: Berechnung der Gütemerkmale, Teil 4: Methoden zur Messung ÖNORM O 1051 "Straßenbeleuchtung, Beleuchtung von Konfliktzonen": ergänzender, nationaler Teil zur EN 13201; regelt die Errichtung von Beleuchtungsanlagen bei Schutzwegen, Radfahrer-Überfahrten, Kreisverkehren, Fahrbahnteilern, Parkplätzen, Kreuzungen und Busbuchten. ÖNORM O 1052 "Lichtimmissionen": Grenzwerte werden definiert und Wege aufgezeigt, um zweckdienliches Licht zu erzeugen und störende Lichteinwirkungen auf den menschlichen Lebensraum und die Umwelt zu vermeiden. ÖNORM O 1053 "Berücksichtigung des situativen Verkehrsflusses": ergänzender, nationaler Teil zur EN 13201; regelt u.a. unter welchen Voraussetzungen das Lichtniveau oder die Helligkeit einer (normgerechten) Straßenbeleuchtung in der verkehrsarmen Zeit abgesenkt oder reduziert werden kann bzw. darf. ÖNORM EN 12193: Sportstättenbeleuchtung ÖNORM EN 12464-2: Beleuchtung von Arbeitsstätten/Arbeitsplätzen im Freien ÖNORM EN 50110: Betrieb von elektrischen Anlagen ÖNORM EN 40: Vorgaben für die Bemessung und Prüfung von Lichtmasten ÖVE/ÖNORM E 8001-4: elektrotechnische Sicherheitsvorschriften EU-Verordnung 245/2009: Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und Leuchten. Die Verordnung enthält Energie-Effizienz-Anforderungen an Lampen, Vorschaltgeräte und Leuchten für die Straßenbeleuchtung.
27 Beleuchtungsstärke [Lux, lx]: Die Beleuchtungsstärke gibt den Lichtstrom an, der von der Lichtquelle auf eine bestimmte Fläche trifft. Bei Straßen erfolgt die Messung der horizontalen Beleuchtungsstärke in maximal 20 cm Entfernung vom Boden. Beleuchtungsklasse: Eine Beleuchtungsklasse wird durch eine Reihe von photometrischen Anforderungen definiert, die von den visuellen Bedürfnissen spezifischer Straßennutzer/innen, den verschiedenen Arten von Verkehrsflächen und ihrer Umgebung abhängen. Blendung: Als Blendung wird eine Verminderung der Sehleistung oder Störung der Wahrnehmung durch hohe Leuchtdichten oder Leuchtdichtekontraste bezeichnet. Farbtemperatur [Kelvin, K]: gibt den Blau- bzw. Rotanteil des Lichts an. Rötliches Licht wird als Warmweiß (2.700 bis 3.500 Kelvin), bläuliches Licht als Kaltweiß (5.000 bis 10.000 Kelvin) bezeichnet, dazwischen liegt Neutralweiß (3.500 bis 5.000 Kelvin). Farbwiedergabe [Ra, engl. CRI – Colour Rendering Index]: gibt an, wie natürliche Farben wiedergegeben werden (bester Wert Ra=100) Gleichmäßigkeit: Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke bzw. der Leuchtdichte wird als Verhältnis der minimalen zur mittleren Beleuchtungsstärke bzw. als Verhältnis der minimalen zur mittleren Leuchtdichte in der Straßenbeleuchtung angegeben. Lampe: Leuchtmittel, z. B. Leuchtstofflampe, Halogen-Metalldampflampe, Natriumdampf-Hochdrucklampe LED: Light Emitting Diodes (Leuchtdioden) Leuchtdichte [cd/m 2 ]: Die Leuchtdichte ist der Helligkeitseindruck, den eine beleuchtete oder leuchtende Fläche dem Auge vermittelt. Die Leuchtdichte beschreibt die physiologische Wirkung des Lichtes auf das Auge und wird in der Außenbeleuchtung als Planungsgröße verwendet. Leuchte: Beleuchtungskörper, in den die Lampe eingesetzt wird, besteht aus Gehäuse und Reflektor sowie den zum Betrieb der Lampe notwendigen Betriebsmitteln (Vorschaltgerät, Zündgerät, Kondensator, Anschlussklemmen etc.). Leuchten-Betriebswirkungsgrad: Verhältnis des gesamten durch eine Leuchte emittierten Lichtstroms zum abgegebenen Lichtstrom der eingesetzten Lampen Lichtausbeute [lm/W]: Verhältnis des Lichtstroms einer Lampe pro aufgewendete elektrische Leistung, ist ein Maß für die Effizienz bei der Umwandlung von elektrischer Energie in Licht Lichtstärke [Candela, cd]: Die Lichtstärke ist der Teil des Lichtstromes, der in eine bestimmte Richtung strahlt. Lichtstärkeverteilung: Beschreibt die räumliche Verteilung der Lichtstärke. Lichtstrom [Lumen, lm]: die gesamte Lichtleistung, die von einer Lampe in alle Richtungen abgegeben wird Lichtstromrückgang: Verringerung der Lichtausbeute im Laufe der Nutzungsdauer. Lichtverschmutzung: Lichtverschmutzung bezeichnet die Summe aller nachteiligen Auswirkungen von Kunstlicht auf Natur und Landschaft. Wartungsfaktor, Planungsfaktor: ist der bei der Beleuchtungsplanung verwendete Korrekturfaktor zum Ausgleichen des Lichtstromrückgangs auf Grund der Lampenalterung (Lichtstromrückgang und Lampenausfall) und der Verschmutzung. Er bestimmt den erforderlichen Wartungszyklus. Begriffe
www.energiesparverband.at beraten | fördern | informieren | vernetzen | ausbilden Haushalte | Gemeinden | Unternehmen Energiesparen in Gemeinden kann das Gemeindebudget deutlich entlasten und einen Beitrag zum praktischen Umweltschutz leisten. Neben der Kosteneinsparung kann die Gemeinde als Anlaufstelle für Gemeindebürger/ innen auch zur Information beim effizienten Umgang mit Energie beitragen. Energieberatung für Gemeinden: Energie-eff iziente Straßenbeleuchtung Diese Broschüre informiert über: Wie kann effiziente Straßenbeleuchtung praktisch umgesetzt werden? Ist Contracting in meinem Fall eine sinnvolle Lösung? Was tun bei anstehender Sanierung? Was sind die wichtigsten Komponenten der Straßenbeleuchtung? Was können LEDs heute in der Straßenbeleuchtung? Wie steht es um Wirtschaftlichkeit & Finanzierung? Energiesparen in Gemeinden OÖ Energiesparverband | Landstraße 45, 4020 Linz | 0732-7720-14380, office@esv.or.at www.energiesparverband.at | find us on facebook | ZVR 171568947 Der OÖ Energiesparverband bietet den Kommunen Unterstützung bei allen Fragen rund um Energie-Eff i- zienz und erneuerbare Energieträger. Die kostenlose Beratung kann dabei Themen wie Neubau bzw. Sanie- rung von gemeindeeigenen Gebäuden, Einsatz von erneuerbaren Energieträgern, Planung und Umset- zung von Energie-Contracting-Projekten sowie Hilfe- stellungen bei Ausschreibungen wie z. B. Architektur- Wettbewer ben umfassen. Der OÖ Energiesparverband betreut das "E-GEM-Programm" des Landes OÖ für Energiespar gemeinden. Co-funded by the Intelligent Energy EuropeProgramme of the European Union So werden Sie kostenlos Energie- kosten los: Die Expert/innen des Energiespar-verbandes des Landes Oberöster-reich beraten Sie produktunabhän-gig und kostenlos. www.energiesparverband.at